|
Startseite - Rechtsanwaltskammer Hamm
|
|
͏
|
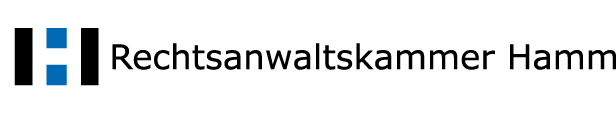
|

|
|
KammerInfo |
|
Ausgabe Nr. 10/2025 vom 29. August 2025 |
|
|
|
| |
|
beA: Abkündigung des Kartenlesegerätes cyberJack Secoder |
|
Voraussichtlich ab Herbst 2025 wird die im besondere elektronischen Anwaltspostfach (beA) zur Ansteuerung der Kartenlesergeräte eingesetzte Standardsoftware das Kartenlesegerät cyberJack secoder der Firma REINER SCT nicht mehr unterstützen. Dies bedeutet, dass dieses Gerät dann für das Arbeiten im beA nicht mehr genutzt werden kann.
Grund für die Abkündigung ist, dass die Firma REINER SCT bereits vor einiger Zeit den Support für dieses Gerät eingestellt hat. Es wurde in der Einführungsphase des beA zwischen 2015 und 2017 hergestellt, seine Nutzung ist relativ weit verbreitet. Die neuesten Sicherheitsanforderungen lassen sich darauf jedoch nicht mehr abbilden. Dies trifft auch auf weitere ältere Kartenlesegeräte zu, die ebenfalls vom Hersteller abgekündigt wurden.
Bitte stellen Sie frühzeitig sicher, dass Sie über ein neueres Kartenlesegerät verfügen, über das Sie mit Ihrer beA-Karte weiterhin das beA-System nutzen können.
Details dazu, wie Sie erkennen, ob das von Ihnen genutzte Gerät betroffen ist, welche Geräte im beA-System unterstützt werden und was Sie bei Ihrer Entscheidung für ein alternatives Gerät berücksichtigen sollten, erfahren Sie in den Hinweisen des beA-Anwendersupports.
Sie können darüber hinaus auch ein Softwarezertifikat bei der Zertifizierungsstelle der Bundesnotarkammer bestellen, über das Sie auch ohne Verwendung eines Kartenlesegeräts auf das beA-System und die mobile beA-App zugreifen können. Bitte beachten Sie aber, dass für einige Aktivitäten, z.B. die Erstregistrierung oder die Vergabe von Berechtigungen, die Anmeldung mittels einer beA-Karte erforderlich ist. Das Softwarezertifikat reicht hierzu nicht aus.
| |
|
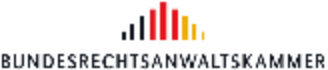
|
|
|
|
| |
|
Notariat: Beurkundungen sollen digital möglich werden |
Notarielle Urkunden werden derzeit überwiegend papiergebunden erstellt. Bereits seit 2022 erfolgt jedoch ihre Verwahrung im elektronischen Urkundenarchiv. Zudem müssen ab dem 1.1.2026 Gerichtsakten elektronisch geführt werden. Die Urkunden werden also digital erstellt, dann ausgedruckt und signiert und müssen anschließend zum Zweck von Vollzug und Verwahrung wieder digitalisiert werden. Diesen doppelten Medienbruch will das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz künftig vermeiden.
Dazu sieht ein Mitte Juni vorgelegter Referentenentwurf des Ministeriums für ein Gesetz zur Einführung einer elektronischen Präsenzbeurkundung vor, dass Beurkundungen künftig auch in Präsenzverfahren elektronisch möglich sein sollen. Die Urkundsperson soll die Niederschrift unmittelbar als elektronisches Dokument erstellen können. Die Beteiligten können sie dann entweder mit ihrer qualifizierten elektronischen Signatur versehen oder sie mit Hilfsmitteln wie z.B. einem Touchscreen oder einem Unterschriftenpad digital unterschreiben. Abschließend bringt die Urkundsperson ihre digitale Signatur an und gewährleistet so die Authentizität und Integrität der Urkunde.
Für Notarinnen und Notare soll die Bundesnotarkammer ein Signatursystem für elektronische Präsenzbeurkundungen bereitstellen. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass die erforderliche Softwareausstattung für diese Berufsgruppe flächendeckend und niedrigschwellig zeitnah zur Verfügung steht.
Auch elektronische Beglaubigungen sollen vereinfacht werden, indem auch hier eigenhändige elektronische Unterschriften auf einem elektronischen Hilfsmittel ermöglicht werden sollen. Außerdem soll künftig der Zugang einer öffentlich beglaubigten Abschrift genügen, damit eine Erklärung wirksam wird. Der Zugang soll mittels elektronisch beglaubigter Abschriften auch auf elektronischem Weg möglich sein.
Der Referentenentwurf entspricht im Wesentlichen einem Entwurf aus der vergangenen Legislaturperiode, der infolge des vorzeitigen Regierungswechsels der Diskontinuität unterfiel. Ergänzend enthält der aktuelle Entwurf neben redaktionellen Änderungen u.a. eine Änderung, mit der die bundesweit einheitlichen Standards für die allgemeine Beeidigung, die im Gerichtsdolmetschergesetz geschaffen wurden, auch für das Beurkundungsverfahren abgebildet werden sollen. | |
|
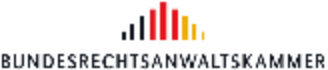
|
|
|
|
| |
|
Geplante Erprobung von Online-Verfahren |
Streitigkeiten mit geringen Streitwerten sollen nach Plänen des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) künftig in einem schnellen Online-Verfahren durchgesetzt werden können. Das neue Verfahren soll generell für Geltendmachung von Geldforderungen vor den Amtsgerichten nutzbar sein. Dafür soll eine bundeseinheitliche digitale Plattform für die Verfahrenskommunikation geschaffen werden, in die auch die bereits bestehende Infrastruktur des besonderen elektronischen Anwaltspostfachs (beA) integriert werden soll.
Wegen der föderalen Struktur der Justiz und ihren unterschiedlich ausgeprägten IT-Landschaften soll zunächst durch eine Erprobungsgesetzgebung die Möglichkeit geschaffen werden, digitale Verfahrensabläufe und neue Technologien bundeseinheitlich zu testen. Der Mitte Juni vom BMJV vorgelegte Referentenentwurf eines Gesetzes zur Entwicklung und Erprobung eines Online-Verfahrens in der Zivilgerichtsbarkeit sieht dazu die Einfügung eines neuen 12. Buches der Zivilprozessordnung (ZPO) mit entsprechenden Verfahrensregelungen vor. Flankiert wird das Gesetz von einem bundesweiten Digitalisierungsprojekt unter Leitung des BMJV und der DigitalService GmbH des Bundes, an dem sich neun Bundesländer sowie dreizehn Amtsgerichte als Pilotstandorte beteiligen.
Ein im Wesentlichen inhaltsgleicher Entwurf wurde in der vergangenen 20. Legislaturperiode vom Kabinett beschlossen und im Oktober 2024 vom Deutschen Bundestag in erster Lesung beraten, fiel jedoch mit dem vorzeitigen Ende der Legislaturperiode der Diskontinuität anheim.
Im Kern sieht der Entwurf vor, dass Klagen vor den Amtsgerichten, die auf eine Geldzahlung bis 5.000 Euro gerichtet sind, über einheitliche digitale Eingabesysteme erhoben werden. Dazu sollen „Mein Justizpostfach“ für Bürgerinnen und Bürger sowie das beA für die Anwaltschaft genutzt werden. Über eine digitale Kommunikationsplattform sollen alle wesentlichen Verfahrensdokumente übermittelt, Anträge gestellt und Zustellungen vorgenommen werden. Die Verfahrensvorschriften der ZPO werden für die Online-Verfahren angepasst, u.a. sollen Videoverhandlungen ausgeweitet, Beweisaufnahmen erleichtert und mündliche Verhandlungen reduziert werden. Zudem wird ermöglicht, den Streitstoff strukturiert elektronisch aufzubereiten. Als Kostenanreiz für das neue Online-Verfahren soll der Gerichtskostensatz von 3,0 auf 2,0 reduziert werden.
Im Unterschied zum früheren Entwurf enthält der aktuelle Referentenentwurf auch Ergänzungen: Unter anderem werden zwei alternative, jedoch auch kombinierbare Formen der digitalen Strukturierung des Streitstoffs explizit benannt; sie sollen aber weder zu inhaltlichen noch zu umfangsbezogenen Beschränkungen des Parteivortrags führen. Für die Anwaltschaft wichtig ist außerdem die vorgesehene Verpflichtung, Anträge und Erklärungen als strukturierte Datensätze einzureichen. Hierzu soll das beA als Authentifizierungsmittel genutzt werden.
In ihrer Stellungnahme begrüßt die BRAK ausdrücklich, dass zivilgerichtliche Online-Verfahren erprobt werden sollen; die Entwicklung und Erprobung nachhaltiger digitaler Kommunikationsstrukturen zwischen Justiz und Bevölkerung hält sie für dringend geboten. Die BRAK weist jedoch darauf hin, dass die Streitwertgrenze von 5.000 Euro auch dann beibehalten werden sollte, wenn der Zuständigkeitsstreitwert für die Amtsgerichte, wie derzeit angedacht, auf 10.000 Euro erhöht werden sollte.
In Bezug auf die neuen Kommunikationsformen im digitalen Rechtsverkehr und die Entwicklung der digitalen Eingabesysteme fordert die BRAK eine institutionelle Einbindung der Anwaltschaft; dazu müssten Schnittstellen sowie eine Einbindung in Kanzleisoftware sowie in das beA-System ermöglicht werden. Die BRAK fordert weiter, dass die Übermittlung qualifiziert elektronisch signierter anwaltlicher Schriftsätze ebenso wie weiterere qualifiziert signierter Dokumente über die im Referentenentwurf genannten Einreichungswege – etwa zu Beweiszwecken – auch im Online-Verfahren ermöglicht wird.
Auch zu weiteren im Entwurf vorgesehenen Regelungen äußert die BRAK sich in ihrer Stellungnahme mit Blick auf die Auswirkungen für die anwaltliche Praxis und die Systematik der Verfahrensregelungen kritisch. Sie wird auch das weitere Gesetzgebungsverfahren aktiv begleiten. | |
|
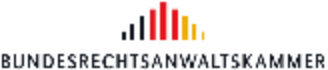
|
|
|
|
| |
|
Neue europäische Geldwäsche-Aufsichtsbehörde AMLA am 1. Juli gestartet |
Zum 1.7.2025 hat die Anti Money Laundering Agency (AMLA) als neue zentrale europäische Behörde ihre Tätigkeit aufgenommen. Die Behörde wurde durch das im Jahr 2021 verabschiedete und am 9.7.2024 in Kraft getretene EU-Geldwäschepaket installiert und hat ihren Sitz in Frankfurt am Main.
Die AMLA soll die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der Europäischen Union effektiver gestalten. Dazu soll sie die nationalen Geldwäscheaufsichtsbehörden koordinieren, für eine kohärente Anwendung der Vorschriften zur Geldwäscheprävention sorgen und die Zusammenarbeit zwischen den zentralen Meldestellen (Financial Intelligence Units – FIU) der Mitgliedstaaten verbessern. Sie wird dazu eng mit der Europäischen Zentralbank sowie mit den europäischen Aufsichtsbehörden für den Finanzsektor (Europan Banking Authority – EBA; European Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA; European Securities and Markets Authority – ESMA) zusammenarbeiten.
Die AMLA baut außerdem ein Netzwerk von Experten für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf. Aus der Rechtsanwaltschaft berief die AMLA – auf Vorschlag des Bundesfinanzministeriums – Rechtsanwältin Laura Funke, stellvertretende Geschäftsführerin der Rechtsanwaltskammer München und ständiges Mitglied der Rechtsanwaltskammer-Arbeitsgemeinschaft Geldwäscheaufsicht, sowie Rechtsanwalt Dr. Emanuel H. F. Ballo, Mitglied des Vorstands der Rechtsanwaltskammer Frankfurt. Sie werden künftig im europäischen AML/CFT-Expertennetzwerk aktiv mitwirken. | |
|
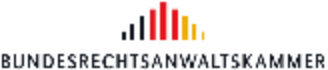
|
|
|
|
| |
|
Höhere Pfändungsfreigrenzen seit dem 1.7.2025 |
|
Die Freigrenzen für pfändbares Arbeitseinkommen nach § 850c der Zivilprozessordnung (ZPO) wurden zum 1.7.2025 insgesamt erhöht. Die entsprechende Bekanntmachung des Bundesministeriums der Justiz wurde am 11.4.2025 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht.
Seit dem 1.7.2025 beträgt der unpfändbare Betrag nach
- § 850c I 1 ZPO: 1.555,00 Euro (bisher 1.491,75 Euro) monatlich,
- § 850c II 1 ZPO: 585,23 Euro (bisher 561,43 Euro) monatlich,
- § 850c II 2 ZPO: 326,04 Euro (bisher 312,78 Euro) monatlich,
- § 850c III 3 ZPO: 4.766,99 Euro (bisher 4.573,10 Euro) monatlich.
Die entsprechenden wöchentlichen und täglichen Pfändungsfreibeträge sind der Bekanntmachung zu entnehmen. Dort sind auch die konkreten Pfändungsfreibeträge in einer Tabelle dargestellt.
| |
|
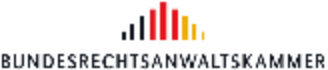
|
|
|
|
| |
|
Aktualisierte Musterbögen für Geldwäsche-Risikoanalysen |
Mit präventiven Pflichten will das Geldwäschegesetz (GwG) verhindern, dass bestimmte Berufsträger unwissentlich von Geldwäschern für kriminelle Geschäfte missbraucht werden. Auch Anwältinnen und Anwälte können aufgrund ihres Spezialwissens und ihrer Verschwiegenheitspflicht attraktiv für Geldwäscher sein. Sie sind jedoch nicht generell, sondern nur dann Verpflichtete nach dem GwG, wenn sie mit der Begleitung bestimmter, im Katalog des § 2 I Nr. 10 GwG aufgezählter Geschäfte betraut sind.
Eine der zentralen präventiven Pflichten nach dem GwG ist die Erstellung einer Risikoanalyse nach § 5 GwG.
Um Anwältinnen und Anwälte bei der Erstellung von Risikoanalysen zu unterstützen, hat die bei der BRAK eingerichtete Arbeitsgruppe Geldwäscheaufsicht der Rechtsanwaltskammern zwei Muster erstellt. Eines betrifft die kanzleiweite Risikoanalyse, das andere die individuelle Risikoanalyse einer in der Kanzlei tätigen Anwältin bzw. eines in der Kanzlei tätigen Anwalts. Die Muster wurden bewusst als ausführliche Beispiele gestaltet und können als Hilfestellung bei der Erstellung einer Risikoanalyse gem. § 5 GwG genutzt werden.
Die Muster-Risikoanalysen wurden nun in einer aktualisierten Auflage veröffentlicht. Sie wurden insgesamt gestrafft und übersichtlicher gestaltet. Zudem wurden sie an die aktuellen Quellen zur Risikobestimmung sowie den aktuellen Stand der Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG angepasst. Neu ist außerdem, dass die Risikostaaten nicht mehr im Einzelnen im Dokument aufgeführt werden. Die Musterbögen verweisen und verlinken vielmehr auf die aktuellen Listen der Financial Action Task Force (FATF) und der EU-Kommission. Da sich diese Listen fortlaufend ändern, kann so gewährleistet werden, dass die Muster immer auf dem aktuellen Stand sind. | |
|
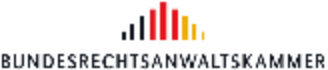
|
|
|
|
| |
|
Justiz: Länder sollen elektronische Akte später einführen dürfen |
Das Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs aus dem Jahr 2013 und seine Folgegesetze – u.a. das Gesetz zur Einführung der elektronischen Akte in der Justiz aus dem Jahr 2017 – sehen die schrittweise Einführung eines flächendeckenden elektronischen Rechtsverkehrs in Deutschland vor. Im Kern gilt danach: Die Anwaltschaft hat seit dem 1.1.2022 Dokumente verpflichtend elektronisch bei Gericht einzureichen; auch für Notare, Steuerberater und weitere regelmäßig in gerichtliche Verfahren involvierte Berufsgruppen gelten bzw. kommen zeitlich gestaffelte Nutzungspflichten. Justiz und Verwaltung müssen zum 1.1.2026 auf elektronische Aktenführung umstellen. Begleitend wurden zudem Register digitalisiert und elektronisches Akteneinsichtsportal eingeführt.
Angesichts unterschiedlicher Fortschritte bei der Einführung der elektronischen Akte in den Gerichtsbarkeiten der Länder sieht das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz das Risiko von Digitalisierungslücken auch nach dem 1.1.2026. Um negative Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege zu vermeiden und weiterhin einen leistungsfähigen Zugang zur Justiz zu gewährleisten, soll den Ländern die Möglichkeit gegeben werden, in bestimmten Verfahrensarten bis längstens zum 1.1.2027 weiterhin papiergebundene Akten zu führen. Die grundlegende Verpflichtung zur elektronischen Aktenführung soll dadurch jedoch nicht aufgehoben werden.
Konkret sieht der Anfang Juli vorgelegte Referentenentwurf des Ministeriums für ein Gesetz Änderung der Vorschriften über die Einführung der elektronischen Akte in der Justiz eine befristet bis zum 1.1.2027 geltende Opt-Out-Regelung für die Länder vor. Sie sollen per Rechtsverordnung in Zivil-, Straf-, Bußgeld- sowie gerichtlichen Strafvollzugsverfahren, ebenso in Familiensachen und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit befristet weiterhin eine papiergebundene Aktenführung zulassen dürfen.
Für Strafverfahren sollen bereits in Papierform angelegte Akten ohne zeitliche Befristung papiergebunden fortgeführt werden dürfen. Dazu bedarf es künftig keiner Rechtsverordnung mehr. Eine solche ist nur noch nötig, wenn eine Akte neu in Papierform angelegt oder eine bereits elektronisch angelegte Akte in Papierform fortgeführt werden soll. Die papiergebundene Anlage oder Fortführung von Akten soll außerdem bis zum 1.1.2027 zulässig sein, wenn die Polizei oder andere Ermittlungsbehörden umfangreiche Papierakten übermitteln und die elektronische Aktenführung unverhältnismäßig aufwändig wäre. Auch in den weiteren Fällen, in denen nach geltendem Recht die Fortführung von Papierakten oder eine hybride Aktenführung zulässig ist, soll künftig auf den Erlass einer Rechtsverordnung verzichtet werden können.
Für die Verfahren vor den Anwaltsgerichten und den Anwaltsgerichtshöfen gelten über § 116 bzw. § 112c BRAO die Vorschriften über elektronische Strafakten (§ 32 StPO) bzw. die verwaltungsprozessualen Vorschriften (§ 55b VwGO). Auch insoweit können daher – entsprechend dem oben zu den jeweiligen Verfahrensarten Gesagten – papiergebundene Akten ohne zeitliche Prämisse fortgeführt werden, ohne dass es einer Rechtsverordnung bedarf. | |
|
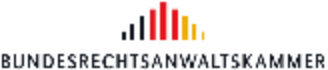
|
|
|
|
| |
|
Zuständigkeitsstreitwerte: Anwaltliche Vertretung darf nicht auf Kostenfaktor reduziert werden |
Das Bundesjustizministerium plant, den Streitwert, bis zu dem die Amtsgerichte in Zivilsachen zuständig sind, von derzeit 5.000 Euro auf 10.000 Euro zu verdoppeln. Das sieht ein Ende Juni vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz veröffentlichter Referentenentwurf vor. Zudem sollen die Zuständigkeiten für bestimmte Streitigkeiten unabhängig von deren Wert bei den Amts- bzw. Landgerichten konzentriert werden, um eine bessere Spezialisierung der Gerichte zu ermöglichen.
Die BRAK begrüßt grundsätzlich das formulierte Ziel, die Amtsgerichte in der Fläche zu stärken, sowie den Ansatz, die seit der letzten Anpassung vor über 30 Jahren eingetretene Inflation zu berücksichtigen. In gleicher Weise hatte sie sich auch bereits zu dem gleichgelagerten Reformvorhaben geäußert, das infolge des vorzeitigen Endes der vergangenen Legislaturperiode der Diskontinuität unterfallen war.
Kritik übt die BRAK jedoch daran, dass es dem Referentenentwurf sowohl an empirischer Grundlage als auch an flankierenden Maßnahmen zur strukturellen und personellen Absicherung der Gerichte fehlt – obwohl die Gerichte zeitgleich auch durch laufende Digitalisierungsprozesse belastet sind. Dies wäre jedoch ein zwingend notwendiger erster oder zumindest paralleler Schritt, bevor der Zuständigkeitsstreitwert in so erheblicher Größenordnung erhöht wird.
Problematisch ist aus Sicht der BRAK ferner, dass der Entwurf mögliche Wechselwirkungen mit parallel laufenden Reformvorhaben außer Betracht lässt. Dies gilt besonders für den jüngst veröffentlichten Referentenentwurf zum Online-Verfahren in der Zivilgerichtsbarkeit, der sich auf die Geltendmachung von Geldforderungen vor den Amtsgerichten bezieht.
Darüber hinaus weist die BRAK auf die Gefahr einer unübersichtlichen Zersplitterung der sachlichen Zuständigkeiten hin. Diese kann insbesondere für rechtsunkundige Bürgerinnen und Bürger den Zugang zum Recht erschweren.
Ein weiterer Kritikpunkt der BRAK ist das in der Gesetzesbegründung zum Ausdruck kommende unzureichende Verständnis von der Rolle der Anwaltschaft. Auf lediglich spekulativer Grundlage wird für etwa 9.000 Verfahren jährlich der Wegfall anwaltlicher Vertretung prognostiziert – und damit eine finanzielle „Entlastung“ von rund 14,5 Mio. Euro. Damit werde die Anwaltschaft auf einen bloßen Kostenfaktor reduziert und ihre Rolle nicht nur als Rechtsberater und -vertreter, sondern auch als ein Faktor im Prozess, der zur Verfahrensökonomie beiträgt, negiert.
Die BRAK fordert zudem die Beibehaltung des Anwaltszwangs sowie die Sicherung eines Gleichlaufs der Vergütung im Rahmen der Prozesskostenhilfe und der Wahlanwaltschaft. | |
|
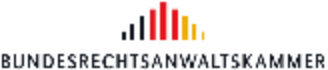
|
|
|
|
| |
|
Streitwertkatalog für die Verwaltungsgerichte aktualisiert |
Der Streitwertkatalog für die Verwaltungsgerichtsbarkeit liegt seit Ende Februar in einer aktualisierten Fassung vor. Er enthält Empfehlungen, die die Verwaltungsgerichte aller Instanzen im Rahmen ihres Ermessens bei der Festsetzung des Streitwerts zu Grunde legen können. Die Neufassung soll aktuellen Entwicklungen in der Rechtsprechung und Anregungen aus der Anwaltschaft Rechnung tragen.
Die Überarbeitung des zuletzt im Jahr 2013 angepassten Katalogs wurde durch die Präsidentinnen und Präsidenten der Oberverwaltungsgerichte und Verwaltungsgerichtshöfe der Länder sowie durch den Präsidenten des Bundesverwaltungsgerichts initiiert. Auf ihrer 61. Jahrestagung im September 2022 richteten sie eine Kommission aus Richterinnen und Richtern aller Instanzen ein, die unter der Federführung des Bundesverwaltungsgerichts tätig wurde.
Grundlage der Neubewertung war eine umfangreiche Umfrage zur Streitwertpraxis bei den Verwaltungsgerichten und beim Bundesverwaltungsgericht. Darüber hinaus wurden – wie bereits bei früheren Aktualisierungen – praxisrelevante Hinweise der BRAK sowie des Deutschen Anwaltvereins einbezogen. Ziel war es, eine konsistente und möglichst einheitliche Streitwertpraxis zu fördern. Im Vergleich zur vorherigen Fassung wurden die Streitwerte dabei im wesentlichen angehoben.
Der Streitwertkatalog enthält grundsätzlich – soweit nicht auf gesetzliche Bestimmungen hingewiesen wird – keine normativen Vorgaben, sondern orientiert sich an § 52 Gerichtskostengesetz (GKG) sowie § 33 I Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) und bietet lediglich unverbindliche Empfehlungen für verschiedene verwaltungsrechtliche Verfahrensarten im Rahmen der richterlichen Ermessensausübung. Der Katalog soll zur Transparenz und Vorhersehbarkeit der Kostenstruktur beitragen und wird regelmäßig von Gerichten, Anwaltschaft und Justizbehörden als Orientierungshilfe herangezogen. Der Streitwert ist maßgeblich für die Berechnung der Gerichts- und Anwaltskosten. | |
|
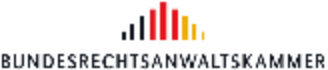
|
|
|
|
| |
|
Elektronische Akte: BRAK kritisiert strukturelle Versäumnisse bei der Einführung |
Bis zum 1.1.2026 hat die Justiz flächendeckend auf elektronische Aktenführung umzustellen. Das regelt das Gesetz zur Einführung der elektronischen Akte in der Justiz aus dem Jahr 2017. Angesichts unterschiedlicher Fortschritte in den Gerichtsbarkeiten der Länder sieht das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz das Risiko von Digitalisierungslücken auch nach dem 1.1.2026.
Um negative Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege zu vermeiden und weiterhin einen leistungsfähigen Zugang zur Justiz zu gewährleisten, sieht ein im Juli vorgelegter Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz vor, dass die Länder mittels einer Opt Out-Regelung den Start der eAkte auf den 1.1.2027 verschieben können.
In ihrer Stellungnahme zu dem Entwurf erkennt die BRAK an, dass der Digitalisierungsstand einzelner Gerichte heterogen und nach wie vor unzureichend ist. Daher könnte die Beibehaltung der Frist zur bundeseinheitlichen Einführung der eAkte bis zum 1.1.2026 zu erheblichen Funktionsstörungen im Justizsystem führen. Vor diesem Hintergrund sieht die BRAK die vorgesehene Opt Out-Regelung als sachgerecht an, letztlich ist sie aus Sicht der BRAK jedoch eine symptomatische Reaktion auf strukturelle Versäumnisse. Dass über acht Jahre nach dem gesetzlichen Auftrag zur Einführung der elektronischen Akte keine flächendeckende Umsetzung erfolgt ist, offenbart erhebliche Defizite in der normativen Durchsetzung und wirft grundlegende Fragen hinsichtlich der erfolgten Steuerung, Priorisierung und Ressourcenausstattung der Justizverwaltung auf.
Als besonders kritisch bewertet die BRAK die Möglichkeit, bereits digital begonnenen Akten in bestimmten Fällen – etwa im Strafverfahren bei papiergebundener Übermittlung durch Ermittlungsbehörden – wieder in Papierform fortzuführen. Dies konterkariert den Anspruch an eine durchgehende digitale Prozesskette. Die BRAK mahnt zudem, dass hierdurch der entstehende Mehraufwand faktisch auf die Anwaltschaft verlagert wird, etwa im Rahmen der Akteneinsicht durch notwendiges Einscannen. Zudem wächst die Kluft zwischen den Digitalisierungsständen einzelner Gerichte weiter – während einige künftig das Online-Verfahren erproben, führen andere Gerichte noch Papierakten.
Die BRAK appelliert an die Länder, die verbleibenden Monate bis zum 1.1.2026 entschlossen zu nutzen, um bestehende Hemmnisse bei der Umsetzung der eAkte zu beseitigen, Ressourcen zu bündeln und klare Prioritäten zu setzen. Ein funktionierender Rechtsstaat darf sich aus ihrer Sicht keine weitere Verschleppung digitaler Infrastruktur leisten. Ziel muss bleiben, Medienbrüche zu vermeiden und die bundeseinheitliche elektronische Aktenführung zu forcieren – für alle Gerichte, Verfahrensordnungen und Instanzen.
Die BRAK weist außerdem darauf hin, dass dies auch für eigenständige staatliche Gerichtsbarkeiten für besondere Sachgebiete – etwa die Anwaltsgerichtsbarkeit – gelten muss. Soweit die im Referentenentwurf verankerte Opt Out-Regelung verabschiedet wird, bedarf es auch eines Gleichlaufs zwischen der Führung der elektronischen Akten bei den Anwaltsgerichten und der elektronischen Aktenführung in Strafsachen. | |
|
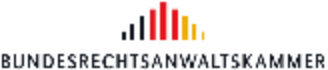
|
|
|
|
| |
|
Zwangsvollstreckung: Pläne zum Ausbau der Digitalisierung |
Seit Beginn der aktiven Nutzungspflicht des elektronischen Rechtsverkehrs für die Anwaltschaft am 1.1.2022 hat sich die Zahl hybrid vorliegender Aufträge und Anträge bei Vollstreckungsgerichten deutlich erhöht. Denn auch an Gerichtsvollzieher werden aus Effizienzgründen zahlreiche Anträge elektronisch übermittelt. Die vollstreckbare Ausfertigung des Titels wird jedoch weiterhin ausschließlich in Papierform erteilt und muss in dieser Form vorgelegt oder übergeben werden. Dieser Medienbruch führt zu Mehraufwand und birgt Zuordnungsprobleme.
Mit dem im Juli vorgelegten Entwurf eines Gesetzes zur weiteren Digitalisierung der Zwangsvollstreckung will das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz die Zahl hybrider Aufträge und Anträge deutlich reduzieren. Dazu soll u.a. die elektronische Übermittlung der vollstreckbaren Ausfertigung an den Gerichtsvollzieher künftig ausreichen. Zudem sollen künftig weitere Beteiligte in Zwangsvollstreckungsverfahren verpflichtend den elektronischen Rechtsverkehr nutzen müssen.
In ihrer Stellungnahme begrüßt die BRAK, dass die Digitalisierung in der Zwangsvollstreckung vorangetrieben und für alle Titelarten und in unbegrenzter Forderungshöhe die Einreichung der Schuldtitel als elektronisches Dokument vorgesehen werden soll. Das Ziel, Medienbrüche künftig nach Möglichkeit zu vermeiden, unterstützt die BRAK, ebenso den Ansatz, die Digitalisierung der Zwangsvollstreckung dem voranschreitenden Digitalisierungsniveau des zivilprozessualen Erkenntnisverfahrens anzupassen, um eine effektive Rechtsdurchsetzung zu ermöglichen.
Laut der Gesetzesbegründung soll dazu mittelfristig ein digitales Vollstreckungsregister für den Nachweis von Vollstreckungsvoraussetzungen geschaffen werden. Vorarbeiten hierzu hätten bereits begonnen. Die Schaffung eines elektronischen Titelregisters im Sinne des auch von der Reformkommission „Zivilprozess der Zukunft“ vorgeschlagenen „Vollstreckungsregisters“ entspricht einer Forderung der BRAK. Um Medienbrüche zu vermeiden, ist es aus Sicht der Anwaltschaft zwingend erforderlich, dass die Arbeiten an einem solchen Register mit Hochdruck vorangetrieben werden, um die Phase der hybriden Verfahren möglichst kurz zu halten.
Im Interesse der Vermeidung von Medienbrüchen begrüßt die BRAK außerdem, dass die Pflicht, den elektronischen Rechtsverkehr für Aufträge und Anträge in der Zwangsvollstreckung zu nutzen, künftig auch für Personen, die Inkassodienstleistungen erbringen, sowie für die Kreditdienstleistungsinstitute gelten soll. Auch dies entspricht einer Forderung der BRAK.
Grundsätzlich positiv steht die BRAK auch dem Vorhaben gegenüber, dass die Anwaltschaft sowie Inkassounternehmen und Behörden künftig Zwangsvollstreckungsformulare als XJustiz-Datensatz einreichen müssen. Die Umstellung auf strukturierte Datensätze fördert aus ihrer Sicht grundsätzlich die digitale Weiterverarbeitung eingereichter elektronischer Dokumente. Um Rechtsunsicherheiten zu vermeiden, fordert sie eine Klarstellung, ob ein Zwangsvollstreckungsauftrag weiterhin im Dateiformat PDF einzureichen ist und zusätzlich die Inhaltsdaten über einen XJustiz-Datensatz mitgegeben werden müssen oder ob der XJustiz-Datensatz den Zwangsvollstreckungsauftrag im PDF-Format ersetzen soll.
Zur Ausgestaltung der Einreichung als bzw. mit strukturierten Datensätzen im Verordnungsweg und zu deren technischer Umsetzung äußert sich die BRAK differenziert. Sie verweist hierzu u.a. auf die Möglichkeit, ein einheitliches Tool zum externen Erzeugen der Strukturdatensätze bereitzustellen, so wie dies bereits beim Schutzschriftenregister erfolgreich praktiziert wird. Solange noch nicht sichergestellt ist, dass einheitliche Datensätze zur Verfügung stehen, fordert die BRAK, dass die Verwendung der XJustiz-Datensätze allenfalls als Soll-Vorschrift ausgestaltet werden darf, weil die Anwaltschaft keine Möglichkeit habe, diesen Anforderungen nachzukommen. Ferner fordert sie eine großzügige Übergangsfrist, da zur Erfüllung der Pflicht zur Einreichung von strukturierten maschinenlesbaren Anträgen umfangreiche Programmierarbeiten bei den Herstellern der Kanzleisoftware-Produkte und auch bei der BRAK als Betreiberin der beA-Webanwendung erforderlich sind.
Die BRAK hatte bereits in der 20. Legislaturperiode zum damaligen Referentenentwurf eines Gesetzes zur weiteren Digitalisierung der Zwangsvollstreckung Stellung genommen. Dieser unterfiel aufgrund des vorzeitigen Endes der Legislaturperiode der Diskontinuität. | |
|
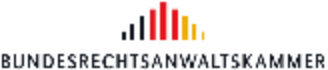
|
|
|
|
| |
|
Vergaberecht: Bedenken gegen Einschränkung von Rechtsbehelfen |
|
Mit dem Gesetz zur Beschleunigung der Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabebeschleunigungsgesetz) sollen umfangreiche Maßnahmen zur Vereinfachung, Beschleunigung und Digitalisierung bei der Vergabe öffentlicher Aufträge umgesetzt werden. Dabei handelt es sich um ein wichtiges Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag der Regierungsfraktionen, das auch in einem Sofortprogramm der Bundesregierung enthalten ist. Es zielt insbesondere darauf, die Umsetzung von Infrastrukturprojekten zu vereinfachen und zu beschleunigen.
Das Vorhaben greift die Bestrebungen des in der letzten Legislaturperiode angestoßenen, aber nicht verabschiedeten Vergabetransformationsgesetzes auf und betrifft vorwiegend Änderungen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), ferner enthält es auch Änderungen im Haushaltsgrundsätzegesetz, in der Bundeshaushaltsordnung, im Wettbewerbsregistergesetz sowie in den Vergabeverordnungen. Nachdem das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie Anfang Juli einen Referentenentwurf vorlegte, dem eine nur vier Werktage umfassende Verbändeanhörung folgte, beschloss das Bundeskabinett am 6.8.2025 den Gesetzentwurf. Er sieht im Kern vor:
- eine neue Abweichungsmöglichkeit vom Losgrundsatz für dringliche Infrastrukturvorhaben aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität, deren geschätzte Auftrags- oder Vertragswert die EU-Schwellenwerte um das 2,5fache übersteigt,
- die Erweiterung der Verordnungsermächtigung der Bundesregierung um ausdrückliche Vorgaben zur Beschaffung von klimafreundlichen Produkten,
- die Streichung der im früheren Entwurf vorgesehenen verpflichtenden Vorgaben zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeit in Vergabeverfahren,
- die Erhöhung der Wertgrenze für Direktauftragsvergaben des Bundes auf 50.000 Euro und die parallele Erhöhung der Schwellenwerte für die Meldepflicht an die Vergabestatistik und die Abfragepflicht des Wettbewerbsregisters und
- die Streichung der aufschiebenden Wirkung von Rechtsmitteln im Nachprüfungsverfahren.
Außerdem wurden die vorgesehenen Maßnahmen im Bereich der Verteidigungsbeschaffung in das separate Vorhaben „Planungs- und Beschaffungsbeschleunigungsgesetz für die Bundeswehr“ überführt. Und schließlich werden weitere kleinere inhaltliche Anpassungen vorgenommen sowie viele redaktionelle Anpassungen vorgenommen, insbesondere wegen der Neufassung des Handbuchs der Rechtsförmlichkeit.
In ihrer Stellungnahme begrüßt die BRAK die Zielsetzung des Entwurfs, das Vergaberecht zu vereinfachen, zu beschleunigen und zu digitalisieren. Sie äußert allerdings Bedenken zur Flexibilisierung des Losgrundsatzes dahingehend, dass gerade bei Infrastrukturvorhaben, die den einschlägigen Schwellenwert nur knapp überschreiten, der Losgrundsatz nicht nur zu einer verzögerten Realisierung führt, sondern auch zu einem Mehraufwand, der insbesondere von kleineren Kommunen nur schwer zu stemmen ist. Die BRAK regt daher an, die Ausnahme vom Losgrundsatz nicht auf das Zweieinhalbfache der einschlägigen EU-Schwellenwerte zu begrenzen.
Ebenso bestehen aus Sicht der BRAK gegen die Neuregelungen zur Abschaffung der aufschiebenden Wirkung der sofortigen Beschwerde vor allem europarechtliche und verfassungsrechtliche Bedenken Die BRAK lehnt die Abschaffung der aufschiebenden Wirkung eines Rechtsmittels gegen die den Nachprüfungsantrag abweisende Entscheidung der Vergabekammer ab.
Die äußerst kurze Frist zur Stellnungnahme von nur vier Werktagen ermöglichte der BRAK nur eine Befassung mit den Kernaspekten des Entwurfs.
Das Gesetz bedarf der Zustimmung des Bundesrates.
| |
|
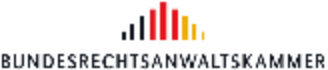
|
|
|
|
| |
|
Symposium zum Anwaltsrecht des Oberlandesgerichts Hamm am 30.09.2025 |
|
Am 30.9.2025, 10:00 – 15:00 Uhr, findet im OLG Hamm (Heßlerstr. 53) ein Symposium zum Anwaltsrecht statt.
Das OLG Hamm ist seit dem 01.07.2025 landesweit zuständig für Berufungsverfahren in Rechtsstreitigkeiten aus der der Berufstätigkeit der rechts-, steuer- und wirtschaftsberatenden Berufe. Damit ist die Entscheidung zivilrechtlicher Fragen betreffend die Berufsausübung und die berufliche Verantwortung landesweit an einem Kompetenzstandort gebündelt worden.
Die Veranstaltung wird eröffnet mit Grußworten von Landesjustizminister Dr. Benjamin Limbach, des Präsidenten der Bundesrechtsanwaltskammer RAuN Dr. Ulrich Wessels und von RA Horst Leis, LL. M., dem Vorsitzenden des Landesverbands NRW im DAV.
Folgendes Fachprogramm ist geplant:
- „Fragen der Anwaltshaftung im Zusammenhang mit dem elektronischen Rechtsverkehr“
VorsRiOLG Hans-Jochen Grewer
- „Mandatsbearbeitung in Anwaltshaftungssachen aus anwaltlicher Sicht“
RA Helmut Kerkhoff, Stallmeister Rechtsanwälte, Hamm
- „Anwaltliche Vergütungsvereinbarungen in der aktuellen Rechtsprechung“
Prof. Dr. Matthias Kilian, Institut für Anwaltsrecht Universität Köln
- „Anwaltshaftung und KI“
RA Dr. Thomas Klein und RA Tobias Kordes, LL. M., Köln
- „Vorsicht: Subsidiarität!“
RA beim BGH Dr. Siegfried Mennemeyer, Karlsruhe
- „Der Regress des Rechtsschutzversicherers, oder: Ist auf die Deckungszusage Verlass?“
RiBGH Sascha Piontek
Durch die Veranstaltung führt RA Martin W. Huff, Singen.
Anmeldeschluss ist der 16.09.2025. Anmelden können Sie sich unter www.beteiligung.nrw.de. | |
|
|
|
|
| |
|
Streitwertgrenzen für Rechtsmittel sollen deutlich erhöht werden |
|
Ein aktueller Gesetzentwurf sieht vor, die Streitwerte, bis zu denen Amtsgerichte für zivilrechtliche Streitwerte zuständig sind, von derzeit 5.000 Euro auf 10.000 Euro zu erhöhen; zudem werden neue Spezialzuständigkeiten der Landgerichte geschaffen. Unter anderem, um einen Gleichlauf mit diesem Vorhaben herzustellen, erwägt das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz kurzfristig eine Erhöhung der Rechtsmittelstreitwerte in der Zivilprozessordnung (ZPO), im Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), im Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG), in der Strafprozessordnung (StPO) sowie im Kostenrecht (GKG, FamGKG, GNotKG, JVEG, RVG). Entsprechendes soll für die Wertgrenze für das Verfahren nach billigem Ermessen (§ 495a ZPO) gelten. Die in der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Finanzgerichtsordnung (FGO) und im Sozialgerichtsgesetz (SGG) vorgesehenen Wertgrenzen sollen jedoch separat im Rahmen der dort anstehenden Reformen erörtert werden.
Die Erhöhung steht außerdem vor dem Hintergrund der für 2027 anstehenden PEBB§Y-Vollerhebung, mit der die Personalbedarfe in den deutschen Justizbehörden anhand von Fallzahlen und Bearbeitungszeiten berechnet werden. Zugrunde liegt den Überlegungen des Ministeriums außerdem die Annahme, dass Rechtsmittel bei geringeren Streitwerten oftmals eine hohe Bedeutung sowohl für die Parteien als auch für eine einheitliche Rechtsprechung haben. Dies gelte insbesondere für den Zugang zur Revisionsinstanz, der nicht unverhältnismäßig eingeschränkt oder für bestimmte Sachgebiete faktisch ausgeschlossen werden sollte.
Konkret sollen die Wertgrenzen für Rechtsmittel wie folgt angehoben werden:
- für Berufungen, Beschwerden nach dem FamFG und das Verfahren nach billigem Ermessen im Zwangsvollstreckungsrecht von derzeit 600 Euro auf 1.000 Euro,
- für Nichtzulassungsbeschwerden von derzeit 20.000 Euro auf 25.000 Euro und
- für Kostenbeschwerden von derzeit 200 Euro auf 300 Euro.
Mit Ausnahme der Nichtzulassungsbeschwerden entsprechen die Erhöhungen in etwa der Inflation seit der letzten Anpassung im Jahr 2002 bzw. 2004. Ursprünglich eingeführt wurden die Wertgrenzen, um die Rechtsmittelinstanzen zu entlasten, da für Streitigkeiten unterhalb der Wertgrenzen keine Rechtsmittel möglich sind. Die Erhöhungspläne müssen im Zusammenhang mit der geplanten Erhöhung des Zuständigkeitsstreitwerts der Amtsgerichte gesehen werden, die sich auch auf die Rechtsmittelinstanzen auswirken wird.
| |
|
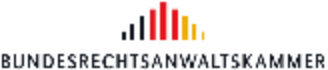
|
|
|
|
| |
|
Seminare der Rechtsanwaltskammer Hamm |
|
Sie können in der nächsten Zeit noch an folgenden Seminaren der Rechtsanwaltskammer Hamm teilnehmen: | |
|
|
|
|
| |
|
Rechtsprechungsübersicht OLG Hamm Juli und August 2025 |
|
Zwischenzeitlich sind die Rechtsprechungsübersichten des OLG Hamm für die Monate Juli 2025 und August 2025 erschienen. | |
|
|
|
|
| |
|
beA-Newsletter |
|
Den aktuellen beA-Newsletter finden Sie hier. | |
|
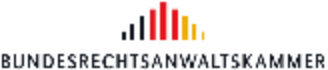
|
|
|
|
| |
|
Nachrichten aus Brüssel |
|
Die aktuellen Nachrichten aus Brüssel finden Sie hier. | |
|
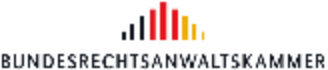
|
|
|
|
| |
|
Impressum
|
Rechtsanwaltskammer für den Oberlandesgerichtsbezirk Hamm
Körperschaft des öffentlichen Rechts, vertreten durch den Präsidenten,
Ostenallee 18, 59063 Hamm
Tel.: 02381/985000, E-Mail: info@rak-hamm.de, Internet: www.rak-hamm.de
Redaktion und Bearbeitung: RA Stefan Peitscher
Zuständige Aufsichtsbehörde:
Der Präsident des Oberlandesgerichts Hamm, Heßlerstraße 53, 59065 Hamm
Zum Abbestellen des Newsletters: Hier klicken!
|
|
|
|